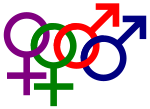Biologie und sexuelle Orientierung - Biology and sexual orientation
| Sexuelle Orientierung |
|---|
| Sexuelle Orientierungen |
| Verwandte Begriffe |
| Forschung |
| Tiere |
| verwandte Themen |
| Teil einer Serie über |
| LGBT-Themen |
|---|
|
|
Der Zusammenhang zwischen Biologie und sexueller Orientierung ist Gegenstand der Forschung. Während Wissenschaftler die genaue Ursache der sexuellen Orientierung nicht kennen , vermuten sie, dass sie durch ein komplexes Zusammenspiel von genetischen , hormonellen und Umwelteinflüssen verursacht wird . Hypothesen zum Einfluss des postnatalen sozialen Umfelds auf die sexuelle Orientierung sind jedoch insbesondere für Männer schwach.
Biologische Theorien zur Erklärung der Ursachen der sexuellen Orientierung werden von Wissenschaftlern bevorzugt. Zu diesen Faktoren, die mit der Entwicklung einer sexuellen Orientierung in Verbindung stehen können, gehören Gene , die frühe Gebärmutterumgebung (wie pränatale Hormone ) und die Gehirnstruktur .
Wissenschaftliche Forschung und Studien
Fötale Entwicklung und Hormone
Der Einfluss von Hormonen auf den sich entwickelnden Fötus ist die einflussreichste Kausalhypothese für die Entwicklung der sexuellen Orientierung. Einfach ausgedrückt beginnt das sich entwickelnde fötale Gehirn in einem "weiblichen" typischen Zustand. Das Vorhandensein des Y-Chromosoms bei Männern führt zur Entwicklung von Hoden, die Testosteron, das primäre Androgenrezeptor-aktivierende Hormon, freisetzen, um den Fötus und das fötale Gehirn zu maskulinisieren. Dieser maskulinisierende Effekt drängt Männer zu männlichen typischen Gehirnstrukturen und meistens zu einer Anziehungskraft auf Frauen. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass schwule Männer in Schlüsselregionen des Gehirns wenig Testosteron ausgesetzt waren oder eine unterschiedliche Empfänglichkeit für seine maskulinisierende Wirkung hatten oder in kritischen Zeiten Schwankungen ausgesetzt waren. Bei Frauen wird die Hypothese aufgestellt, dass eine hohe Testosteronexposition in Schlüsselregionen die Wahrscheinlichkeit einer gleichgeschlechtlichen Anziehung erhöhen kann. Dies wird durch Studien zum Finger- Ziffer-Verhältnis der rechten Hand unterstützt, das ein robuster Marker für die pränatale Testosteronexposition ist. Lesben haben im Durchschnitt deutlich mehr männliche Ziffernverhältnisse, ein Befund, der in kulturübergreifenden Studien mehrfach repliziert wurde. Während direkte Auswirkungen aus ethischen Gründen schwer zu messen sind, können Tierversuche, bei denen Wissenschaftler die Exposition gegenüber Sexualhormonen während der Trächtigkeit manipulieren, auch bei weiblichen Tieren zu lebenslangem männlich-typischem Verhalten und zu einer Zunahme und bei männlichen Tieren zu weiblich-typischem Verhalten führen.
Mütterliche Immunantworten während der Entwicklung des Fötus verursachen nachweislich männliche Homosexualität und Bisexualität. Untersuchungen seit den 1990er Jahren haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass später geborene Söhne schwul sind, umso höher ist, je mehr männliche Söhne eine Frau hat. Während der Schwangerschaft gelangen männliche Zellen in den Blutkreislauf der Mutter, die ihrem Immunsystem fremd sind. Als Reaktion darauf entwickelt sie Antikörper, um sie zu neutralisieren. Diese Antikörper werden dann von zukünftigen männlichen Föten freigesetzt und können Y-gebundene Antigene neutralisieren, die eine Rolle bei der Vermännlichung des Gehirns spielen, wodurch Bereiche des Gehirns, die für die sexuelle Anziehung verantwortlich sind, in der für Frauen typischen Position zurückbleiben oder von Männern angezogen werden. Je mehr Söhne eine Mutter hat, desto höher wird der Spiegel dieser Antikörper, wodurch der beobachtete Effekt der brüderlichen Geburtsreihenfolge entsteht . Biochemische Beweise für diesen Effekt wurden in einer Laborstudie im Jahr 2017 bestätigt, in der festgestellt wurde, dass Mütter mit einem schwulen Sohn, insbesondere mit älteren Brüdern, erhöhte Antikörperspiegel gegen das NLGN4Y-Y-Protein aufwiesen als Mütter mit heterosexuellen Söhnen. J. Michael Bailey hat mütterliche Immunantworten als "ursächlich" für männliche Homosexualität beschrieben. Schätzungen zufolge macht dieser Effekt zwischen 15 und 29 % der schwulen Männer aus, während man annimmt, dass andere schwule und bisexuelle Männer die sexuelle Orientierung genetischen und hormonellen Wechselwirkungen verdanken.
Sozialisationstheorien, die in den 1900er Jahren vorherrschend waren, begünstigten die Idee, dass Kinder "undifferenziert" geboren und in Geschlechterrollen und sexuelle Orientierung sozialisiert wurden. Dies führte zu medizinischen Experimenten, bei denen neugeborene und Säuglinge nach Unfällen wie verpfuschten Beschneidungen chirurgisch Mädchen zugeteilt wurden. Diese Männchen wurden dann als Weibchen aufgezogen und aufgezogen, ohne es den Jungen zu sagen, was sie wider Erwarten weder weiblich noch von Männern angezogen machte. Alle veröffentlichten Fälle, in denen sexuelle Orientierung angegeben wurde, wurden stark von Frauen angezogen. Das Scheitern dieser Experimente zeigt, dass Sozialisationseffekte bei Männern kein weibliches Verhalten hervorrufen oder sie zu Männern hinziehen, und dass die organisatorischen Auswirkungen von Hormonen auf das fötale Gehirn vor der Geburt dauerhafte Auswirkungen haben. Diese weisen auf „Natur“ hin, nicht auf Erziehung, zumindest in Bezug auf die männliche sexuelle Orientierung.
| INAH-3 Volumen im menschlichen Gehirn | |
|
Heterosexuelle (hete) Männer
Homosexuelle (schwule) Männer
Frauen
|
|
| Durchschnittliche Mengen von INAH3 bei heterosexuellen und schwulen Männern und bei Frauen. | |
Der sexuell dimorphe Kern des präoptischen Areals (SDN-POA) ist eine Schlüsselregion des Gehirns, die sich bei Menschen und einer Reihe von Säugetieren (z. B. Schafe/Widder, Mäuse, Ratten) zwischen Männern und Frauen unterscheidet und durch das Geschlecht verursacht wird Unterschiede in der Hormonexposition. Die INAH-3- Region ist bei Männern größer als bei Frauen und gilt als eine kritische Region für das Sexualverhalten. Dissektionsstudien ergaben, dass schwule Männer eine signifikant kleinere INAH-3 hatten als heterosexuelle Männer, die in die weibliche typische Richtung verschoben ist, ein Befund, der erstmals vom Neurowissenschaftler Simon LeVay nachgewiesen und repliziert wurde. Dissektionsstudien sind jedoch aufgrund fehlender Finanzierung und fehlender Gehirnproben selten.
| Äquivalentes SDN bei Schafen | |
|
Heterosexuell orientierte Widder
Homosexuell orientierte Widder
Mutterschafe (Weibchen)
|
|
| Durchschnittliche Volumina der äquivalenten Zellgruppe bei Schafen (oSDN) für heterosexuelle und homosexuelle Widder und für Mutterschafe. Geschlechtsunterschiede werden unter dem Einfluss pränataler Hormone in utero gebildet und nicht erst nach der Geburt erworben. | |
Langzeitstudien an domestizierten Schafen unter der Leitung von Charles Roselli haben ergeben, dass 6-8% der Widder im Laufe ihres Lebens eine homosexuelle Präferenz haben. Die Dissektion von Widdergehirnen fand auch eine ähnlich kleinere (feminisierte) Struktur bei homosexuell orientierten Widdern im Vergleich zu heterosexuell orientierten Widdern in der äquivalenten Gehirnregion des menschlichen SDN, dem ovinen sexuell dimorphen Kern (oSDN). Es wurde auch gezeigt, dass die Größe des Schaf-oSDN in utero und nicht postnatal gebildet wird, was die Rolle pränataler Hormone bei der Maskulinisierung des Gehirns für die sexuelle Anziehung unterstreicht.
Andere Studien am Menschen haben sich auf die Bildgebungstechnologie des Gehirns verlassen, wie zum Beispiel die Forschung von Ivanka Savic, die Hemisphären des Gehirns verglich. Diese Studie ergab, dass heterosexuelle Männer die rechte Hemisphäre um 2% größer hatten als die linke, was von LeVay als bescheidener, aber "hochsignifikanter Unterschied" beschrieben wurde. Bei heterosexuellen Frauen waren die beiden Hemisphären gleich groß. Bei schwulen Männern waren die beiden Hemisphären auch gleich groß oder geschlechtsuntypisch, während bei Lesben die rechte Hemisphäre etwas größer war als die linke, was auf eine kleine Verschiebung in Richtung männlicher Herkunft hindeutet.
Ein vom Evolutionsgenetiker William R. Rice vorgeschlagenes Modell argumentiert, dass ein falsch ausgedrückter epigenetischer Modifikator der Testosteronsensitivität oder -unempfindlichkeit, der die Entwicklung des Gehirns beeinflusst, Homosexualität erklären kann und am besten die Zwillingsdisharmonie erklären kann. Reis et al. schlagen vor, dass diese Epimarks normalerweise die sexuelle Entwicklung kanalisieren, intersexuelle Zustände in der Mehrheit der Bevölkerung verhindern, aber manchmal nicht über Generationen hinweg verschwinden und eine umgekehrte sexuelle Präferenz verursachen. Aus Gründen der evolutionären Plausibilität argumentieren Gavrilets, Friberg und Rice, dass alle Mechanismen für ausschließlich homosexuelle Orientierungen wahrscheinlich auf ihr epigenetisches Modell zurückgehen. Die Überprüfung dieser Hypothese ist mit der aktuellen Stammzelltechnologie möglich.
Genetische Einflüsse
Es wurde festgestellt, dass mehrere Gene eine Rolle bei der sexuellen Orientierung spielen. Wissenschaftler warnen davor, dass viele Menschen die Bedeutung von genetischen und umweltbedingten Faktoren falsch interpretieren . Umwelteinfluss bedeutet nicht automatisch, dass das soziale Umfeld die Entwicklung der sexuellen Orientierung beeinflusst oder dazu beiträgt. Hypothesen zum Einfluss des postnatalen sozialen Umfelds auf die sexuelle Orientierung sind insbesondere für Männer schwach. Es gibt jedoch ein riesiges nicht-soziales Umfeld, das nicht genetisch, aber dennoch biologisch ist, wie die vorgeburtliche Entwicklung , das wahrscheinlich die sexuelle Orientierung mitgestaltet.
Zwillingsstudium

In einer Reihe von Zwillingsstudien wurde versucht, die relative Bedeutung von Genetik und Umwelt bei der Bestimmung der sexuellen Orientierung zu vergleichen. In einer 1991 durchgeführten Studie führten Bailey und Pillard eine Studie mit männlichen Zwillingen durch, die aus „homophilen Publikationen“ rekrutiert wurden, und fanden heraus, dass 52 % der eineiigen (MZ) Brüder (von denen 59 befragt wurden) und 22 % der zweieiigen (DZ) Zwillinge waren Konkordanz für Homosexualität. „MZ“ bezeichnet eineiige Zwillinge mit den gleichen Gensätzen und „DZ“ bezeichnet zweieiige Zwillinge, bei denen die Gene ähnlich wie bei Nicht-Zwillingsgeschwistern gemischt sind. In einer Studie mit 61 Zwillingspaaren fanden die Forscher bei ihren überwiegend männlichen Probanden eine Konkordanzrate für Homosexualität von 66 % bei eineiigen Zwillingen und 30 % bei zweieiigen Zwillingen. Im Jahr 2000 untersuchten Bailey, Dunne und Martin eine größere Stichprobe von 4.901 australischen Zwillingen, berichteten jedoch von weniger als der Hälfte der Konkordanz. Sie fanden eine Konkordanz von 20% bei den männlichen eineiigen oder MZ-Zwillingen und 24% Konkordanz bei den weiblichen eineiigen oder MZ-Zwillingen. Selbstberichtete Zygosität , sexuelle Anziehung, Fantasie und Verhaltensweisen wurden mit einem Fragebogen bewertet und die Zygosität wurde im Zweifelsfall serologisch überprüft. Andere Forscher unterstützen biologische Ursachen für die sexuelle Orientierung von Männern und Frauen.
Eine Studie aus dem Jahr 2008 an allen erwachsenen Zwillingen in Schweden (mehr als 7.600 Zwillinge) ergab, dass das gleichgeschlechtliche Verhalten sowohl durch erbliche genetische Faktoren als auch durch einzigartige Umweltfaktoren (zu denen die pränatale Umgebung während der Schwangerschaft, die Exposition gegenüber Krankheiten im frühen Leben, Gleichaltrige) erklärt werden kann Gruppen, die nicht mit einem Zwilling geteilt werden usw.), obwohl eine Zwillingsstudie nicht feststellen kann, welcher Faktor eine Rolle spielt. Einflüsse der gemeinsamen Umgebung (Einflüsse wie das familiäre Umfeld, die Erziehung, gemeinsame Peergroups, kulturelle und gesellschaftliche Ansichten sowie die gemeinsame Schule und Gemeinschaft) hatten keine Wirkung für Männer und eine schwache Wirkung für Frauen. Dies steht im Einklang mit der allgemeinen Erkenntnis, dass Elternschaft und Kultur bei der männlichen sexuellen Orientierung keine Rolle zu spielen scheinen, bei Frauen jedoch eine geringe Rolle spielen können. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass genetische Einflüsse auf jeden lebenslangen gleichgeschlechtlichen Partner bei Männern stärker waren als bei Frauen, und dass "es vorgeschlagen wurde, dass individuelle Unterschiede im heterosexuellen und homosexuellen Verhalten auf einzigartige Umweltfaktoren wie pränatale Exposition gegenüber Sexualhormonen, fortschreitende mütterliche Immunisierung zurückzuführen sind". auf geschlechtsspezifische Proteine oder neurologische Entwicklungsfaktoren", schließt jedoch andere Variablen nicht aus. Die Verwendung aller erwachsenen Zwillinge in Schweden wurde entwickelt, um der Kritik an freiwilligen Studien Rechnung zu tragen, in denen eine potenzielle Tendenz zur Teilnahme schwuler Zwillinge die Ergebnisse beeinflussen könnte:
Die biometrische Modellierung ergab, dass bei Männern .34–.39 der Varianz [der sexuellen Orientierung], die gemeinsame Umgebung .00 und die individuell-spezifische Umgebung .61–.66 der Varianz genetische Effekte erklärten. Entsprechende Schätzungen bei Frauen waren 0,18–0,19 für genetische Faktoren, 0,16–0,17 für gemeinsame Umweltfaktoren und 0,64–0,66 für einzigartige Umweltfaktoren. Obwohl breite Konfidenzintervalle eine vorsichtige Interpretation nahelegen, stimmen die Ergebnisse mit mäßigen, hauptsächlich genetischen, familiären Auswirkungen und mäßigen bis großen Auswirkungen der nicht geteilten Umgebung (sozial und biologisch) auf das gleichgeschlechtliche Sexualverhalten überein.
Chromosomenverknüpfungsstudien
| Chromosom | Standort | Assoziierte Gene | Sex | Studie 1 | Herkunft | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Chromosom | Xq28 | nur Männer | Hameret al. 1993 | genetisch | ||
| Chromosom 1 | 1p36 | beide Geschlechter | Ellis et al. 2008 | potenzielle genetische Verknüpfung 2 | ||
| Chromosom 4 | 4p14 | nur Frauen | Ganna et al. 2019 | |||
| Chromosom 7 | 7q31 | beide Geschlechter | Ganna et al. 2019 | |||
| Chromosom 8 | 8p12 | NKAIN3 | nur Männer | Mustanskiet al. 2005 | ||
| Chromosom 9 | 9q34 | ABO | beide Geschlechter | Ellis et al. 2008 | potenzielle genetische Verknüpfung 2 | |
| Chromosom 11 | 11q12 | OR51A7 (spekulativ) | nur Männer | Ganna et al. 2019 | Geruchssystem bei Paarungspräferenzen | |
| Chromosom 12 | 12q21 | beide Geschlechter | Ganna et al. 2019 | |||
| Chromosom 13 | 13q31 | SLITRK6 | nur Männer | Sanderset al. 2017 | Diencephalon -assoziiertes Gen | |
| Chromosom 14 | 14q31 | TSHR | nur Männer | Sanderset al. 2017 | ||
| Chromosom 15 | 15q21 | TCF12 | nur Männer | Ganna et al. 2019 | ||
|
1 Gemeldete Primärstudien sind kein schlüssiger Beweis für einen Zusammenhang.
2 Wird nicht als kausal angesehen. |
||||||
Chromosomenverknüpfungsstudien der sexuellen Orientierung haben das Vorhandensein mehrerer beitragender genetischer Faktoren im gesamten Genom gezeigt. 1993 veröffentlichten Dean Hamer und Kollegen Ergebnisse einer Kopplungsanalyse einer Stichprobe von 76 schwulen Brüdern und ihren Familien. Hameret al. fanden heraus, dass die schwulen Männer auf der mütterlichen Seite der Familie mehr schwule männliche Onkel und Cousins hatten als auf der väterlichen Seite. Schwule Brüder, die diesen mütterlichen Stammbaum zeigten, wurden dann auf X-Chromosom-Verknüpfung getestet, wobei zweiundzwanzig Marker auf dem X-Chromosom verwendet wurden, um auf ähnliche Allele zu testen. In einem anderen Ergebnis wurde festgestellt, dass 33 der 40 getesteten Geschwisterpaare ähnliche Allele in der distalen Region von Xq28 aufwiesen, was signifikant höher war als die erwarteten Raten von 50% für brüderliche Brüder. Dies wurde in den Medien im Volksmund als „ Schwulen-Gen “ bezeichnet, was zu erheblichen Kontroversen führte. Sanderset al. berichteten 1998 über ihre ähnliche Studie, in der sie herausfanden, dass 13 % der Onkel von Schwulenbrüdern mütterlicherseits homosexuell waren, verglichen mit 6 % väterlicherseits.
Eine spätere Analyse von Hu et al. die früheren Erkenntnisse repliziert und verfeinert. Diese Studie ergab, dass 67% der schwulen Brüder in einer neuen gesättigten Probe einen Marker auf dem X-Chromosom bei Xq28 teilten. Zwei andere Studien (Bailey et al., 1999; McKnight und Malcolm, 2000) konnten kein Übergewicht schwuler Verwandter in der mütterlichen Linie homosexueller Männer feststellen. Eine Studie von Rice et al. 1999 gelang es nicht, die Xq28-Verknüpfungsergebnisse zu replizieren. Die Metaanalyse aller verfügbaren Kopplungsdaten weist auf eine signifikante Verbindung zu Xq28 hin, weist aber auch darauf hin, dass zusätzliche Gene vorhanden sein müssen, um die vollständige Erblichkeit der sexuellen Orientierung zu erklären.
Mustanskiet al. (2005) führten einen vollständigen Genom-Scan (anstatt nur einen X-Chromosom-Scan) an Einzelpersonen und Familien durch, über die zuvor in Hamer et al. (1993) und Huet al. (1995) sowie weitere neue Themen. In der vollständigen Stichprobe fanden sie keine Verknüpfung mit Xq28.
Ergebnisse der ersten großen, umfassenden multizentrischen genetischen Kopplungsstudie zur männlichen sexuellen Orientierung wurden 2012 von einer unabhängigen Forschergruppe der American Society of Human Genetics veröffentlicht. Die Studienpopulation umfasste 409 unabhängige Paare schwuler Brüder, die mit über 300.000 Einzelnukleotid-Polymorphismus- Marker. Die Daten replizierten stark Hamers Xq28-Ergebnisse, wie sie sowohl durch die Zweipunkt- als auch die Mehrpunkt- (MERLIN) LOD-Score-Zuordnung bestimmt wurden. Eine signifikante Kopplung wurde auch in der perizentromeren Region von Chromosom 8 nachgewiesen, die sich mit einer der Regionen überlappt, die in der vorherigen genomweiten Studie des Hamer-Labors nachgewiesen wurden. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass "unsere Ergebnisse im Zusammenhang mit früheren Arbeiten nahelegen, dass die genetische Variation in jeder dieser Regionen zur Entwicklung des wichtigen psychologischen Merkmals der männlichen sexuellen Orientierung beiträgt". Die sexuelle Orientierung der Frau scheint nicht mit Xq28 verbunden zu sein, obwohl sie mäßig erblich erscheint.
Neben dem geschlechtschromosomalen Beitrag wurde auch ein potenzieller autosomal- genetischer Beitrag zur Entwicklung der homosexuellen Orientierung vorgeschlagen. In einer Studienpopulation von mehr als 7000 Teilnehmern haben Ellis et al. (2008) fanden einen statistisch signifikanten Unterschied in der Häufigkeit der Blutgruppe A zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen. Sie fanden auch heraus, dass „ungewöhnlich hohe“ Anteile homosexueller Männer und homosexueller Frauen im Vergleich zu Heterosexuellen Rh-negativ waren . Da sowohl die Blutgruppe als auch der Rh-Faktor genetisch vererbte Merkmale sind, die durch Allele auf Chromosom 9 bzw. Chromosom 1 gesteuert werden , weist die Studie auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Genen auf Autosomen und Homosexualität hin.
Die Biologie der sexuellen Orientierung wurde in mehreren Tiermodellsystemen eingehend untersucht. Bei der gewöhnlichen Fruchtfliege Drosophila melanogaster ist der vollständige Weg der sexuellen Differenzierung des Gehirns und der von ihm kontrollierten Verhaltensweisen sowohl bei Männern als auch bei Frauen gut etabliert, was ein prägnantes Modell biologisch kontrollierter Balz darstellt. Bei Säugetieren hat eine Gruppe von Genetikern am Korea Advanced Institute of Science and Technology eine weibliche Maus gezüchtet, der ein bestimmtes Gen im Zusammenhang mit Sexualverhalten fehlt. Ohne das Gen zeigten die Mäuse ein männliches Sexualverhalten und eine Anziehungskraft auf den Urin anderer weiblicher Mäuse. Die Mäuse, die das Gen Fucose-Mutarotase (FucM) behielten, wurden von männlichen Mäusen angezogen.
In Interviews mit der Presse haben Forscher darauf hingewiesen, dass der Nachweis genetischer Einflüsse nicht mit genetischem Determinismus gleichgesetzt werden sollte. Laut Dean Hamer und Michael Bailey sind genetische Aspekte nur eine von mehreren Ursachen für Homosexualität.
Im Jahr 2017 veröffentlichte Scientific Reports einen Artikel mit einer genomweiten Assoziationsstudie zur männlichen sexuellen Orientierung. Die Untersuchung umfasste 1.077 homosexuelle Männer und 1.231 heterosexuelle Männer. Ein Gen namens SLITRK6 auf Chromosom 13 wurde identifiziert. Die Forschung unterstützt eine weitere Studie des Neurowissenschaftlers Simon LeVay . LeVays Forschung deutete darauf hin, dass sich der Hypothalamus schwuler Männer von heterosexuellen Männern unterscheidet. Der SLITRK6 ist im Mittelhirn aktiv, wo sich der Hypothalamus befindet. Die Forscher fanden heraus, dass der Schilddrüsen-stimulierende Hormonrezeptor (TSHR) auf Chromosom 14 Sequenzunterschiede zwischen schwulen und heterosexuellen Männern aufweist. Morbus Basedow ist mit TSHR-Anomalien verbunden, wobei frühere Untersuchungen darauf hindeuteten, dass Morbus Basedow bei schwulen Männern häufiger vorkommt als bei heterosexuellen Männern. Untersuchungen haben ergeben, dass Schwule ein geringeres Körpergewicht haben als Heteros. Es wurde vermutet, dass das überaktive TSHR-Hormon das Körpergewicht bei Schwulen senkt, obwohl dies nicht bewiesen ist.
Im Jahr 2018 haben Ganna et al. führten eine weitere genomweite Assoziationsstudie zur sexuellen Orientierung von Männern und Frauen mit Daten von 26.890 Personen durch, die mindestens einen gleichgeschlechtlichen Partner hatten, und 450.939 Kontrollpersonen. Die Daten in der Studie wurden meta-analysiert und aus der britischen Biobank- Studie und 23andMe gewonnen . Die Forscher identifizierten vier häufigere Varianten bei Personen, die über mindestens eine gleichgeschlechtliche Erfahrung auf den Chromosomen 7, 11, 12 und 15 berichteten. Die Varianten auf den Chromosomen 11 und 15 waren spezifisch für Männer, wobei die Variante auf Chromosom 11 in einem olfaktorisches Gen und die Variante auf Chromosom 15, die zuvor mit männlicher Kahlheit in Verbindung gebracht wurden. Die vier Varianten wurden auch mit Stimmungs- und psychischen Störungen korreliert; schwere depressive Störung und Schizophrenie bei Männern und Frauen und bipolare Störung bei Frauen. Keine der vier Varianten konnte jedoch die sexuelle Orientierung zuverlässig vorhersagen.
Im August 2019 kam eine genomweite Assoziationsstudie mit 493.001 Personen zu dem Schluss, dass homosexuellem Verhalten bei beiden Geschlechtern Hunderte oder Tausende von genetischen Varianten zugrunde liegen, wobei insbesondere 5 Varianten signifikant assoziiert sind. Einige dieser Varianten hatten geschlechtsspezifische Wirkungen, und zwei dieser Varianten deuteten auf Verbindungen zu biologischen Signalwegen hin, die die Sexualhormonregulierung und den Geruchssinn beinhalten . Alle Varianten zusammen erfassten zwischen 8 und 25 % der Variation der individuellen Unterschiede im homosexuellen Verhalten. Diese Gene überschneiden sich teilweise mit denen für mehrere andere Merkmale, einschließlich Offenheit für Erfahrung und Risikobereitschaft. Weitere Analysen legten nahe, dass Sexualverhalten, Anziehung, Identität und Fantasien von ähnlichen genetischen Varianten beeinflusst werden. Sie fanden auch heraus, dass die genetischen Effekte, die heterosexuelles von homosexuellem Verhalten unterscheiden, nicht die gleichen sind wie diejenigen, die sich bei Nichtheterosexuellen mit niedrigeren gegenüber höheren Anteilen gleichgeschlechtlicher Partner unterscheiden, was darauf hindeutet, dass es kein einheitliches Kontinuum von heterosexueller zu homosexueller Präferenz gibt, wie vorgeschlagen nach der Kinsey-Skala .
Epigenetische Studien
Eine Studie legt einen Zusammenhang zwischen der genetischen Ausstattung einer Mutter und der Homosexualität ihrer Söhne nahe. Frauen haben zwei X-Chromosomen, von denen eines "ausgeschaltet" ist. Die Inaktivierung des X-Chromosoms erfolgt zufällig im gesamten Embryo, was zu Zellen führt, die in Bezug auf das aktive Chromosom mosaikartig sind. In einigen Fällen scheint es jedoch, dass dieses Abschalten auf nicht zufällige Weise erfolgen kann. Bocklandt et al. (2006) berichteten, dass bei Müttern homosexueller Männer die Zahl der Frauen mit extremer Schiefstellung der X-Chromosom-Inaktivierung signifikant höher ist als bei Müttern ohne schwule Söhne. 13% der Mütter mit einem schwulen Sohn und 23% der Mütter mit zwei schwulen Söhnen zeigten eine extreme Schiefe, verglichen mit 4% der Mütter ohne schwule Söhne.
Reihenfolge der Geburt
Blanchard und Klassen (1997) berichteten, dass jeder weitere ältere Bruder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann schwul ist, um 33% erhöht. Dies ist nun "eine der zuverlässigsten epidemiologischen Variablen, die jemals in der Erforschung der sexuellen Orientierung identifiziert wurden". Um diesen Befund zu erklären, wurde vorgeschlagen, dass männliche Föten eine mütterliche Immunreaktion hervorrufen, die mit jedem aufeinanderfolgenden männlichen Fötus stärker wird. Diese mütterliche Immunisierungshypothese (MIH) beginnt, wenn Zellen eines männlichen Fötus während der Schwangerschaft oder während der Geburt in den Kreislauf der Mutter gelangen. Männliche Föten produzieren HY-Antigene, die "fast sicher an der sexuellen Differenzierung von Wirbeltieren beteiligt sind". Diese Y-gebundenen Proteine würden vom Immunsystem der Mutter nicht erkannt, da sie weiblich ist, was dazu führt, dass sie Antikörper entwickelt, die durch die Plazentaschranke in das fetale Kompartiment gelangen. Von hier aus würden die Anti-Männchen-Körper dann die Blut-Hirn-Schranke (BBB) des sich entwickelnden fötalen Gehirns überqueren, wodurch die geschlechtsdimorphen Gehirnstrukturen relativ zur sexuellen Orientierung verändert werden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der exponierte Sohn mehr von Männern angezogen wird als Frauen. Es ist dieses Antigen, auf das mütterliche HY-Antikörper sowohl reagieren als auch „erinnern“ sollen. Aufeinanderfolgende männliche Föten werden dann von HY-Antikörpern angegriffen, die irgendwie die Fähigkeit der HY-Antigene verringern, ihre übliche Funktion bei der Vermännlichung des Gehirns zu erfüllen.
Im Jahr 2017 entdeckten Forscher einen biologischen Mechanismus bei Schwulen, die dazu neigen, ältere Brüder zu haben. Sie glauben, dass das Neuroligin-4-Y-gebundene Protein dafür verantwortlich ist, dass ein späterer Sohn schwul ist. Sie fanden heraus, dass Frauen signifikant höhere Anti-NLGN4Y-Werte hatten als Männer. Darüber hinaus wiesen Mütter homosexueller Söhne, insbesondere solche mit älteren Brüdern, signifikant höhere Anti-NLGN4Y-Werte auf als die Kontrollproben von Frauen, einschließlich Mütter heterosexueller Söhne. Die Ergebnisse legen einen Zusammenhang zwischen einer mütterlichen Immunantwort auf NLGN4Y und der nachfolgenden sexuellen Orientierung bei männlichen Nachkommen nahe.
Der Effekt der brüderlichen Geburtsreihenfolge gilt jedoch nicht für Fälle, in denen ein Erstgeborener homosexuell ist.
Weibliche Fruchtbarkeit
Im Jahr 2004 führten italienische Forscher eine Studie mit etwa 4.600 Personen durch, die Verwandte von 98 homosexuellen und 100 heterosexuellen Männern waren. Weibliche Verwandte der homosexuellen Männer hatten tendenziell mehr Nachkommen als die der heterosexuellen Männer. Weibliche Verwandte der homosexuellen Männer mütterlicherseits hatten tendenziell mehr Nachkommen als solche väterlicherseits. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass auf dem X-Chromosom genetisches Material weitergegeben wurde, das sowohl die Fruchtbarkeit bei der Mutter als auch die Homosexualität bei ihren männlichen Nachkommen fördert. Die entdeckten Verbindungen würden etwa 20 % der untersuchten Fälle erklären, was darauf hindeutet, dass dies ein hochsignifikanter, aber nicht der einzige genetischer Faktor ist, der die sexuelle Orientierung bestimmt.
Pheromonstudien
In Schweden durchgeführte Untersuchungen haben ergeben, dass schwule und heterosexuelle Männer unterschiedlich auf zwei Gerüche reagieren, von denen angenommen wird, dass sie an der sexuellen Erregung beteiligt sind . Die Forschung zeigte, dass eine Region im Hypothalamus aktiviert wird, wenn sowohl heterosexuelle Frauen als auch schwule Männer einem Testosteron-Derivat ausgesetzt sind, das im Männerschweiß enthalten ist. Heterosexuelle Männer hingegen haben eine ähnliche Reaktion auf eine östrogenähnliche Verbindung, die im Urin von Frauen gefunden wird. Die Schlussfolgerung ist, dass sexuelle Anziehung, egal ob gleichgeschlechtlich oder andersgeschlechtlich, auf biologischer Ebene ähnlich funktioniert. Forscher haben vorgeschlagen, dass diese Möglichkeit weiter untersucht werden könnte, indem man junge Probanden untersucht, um zu sehen, ob ähnliche Reaktionen im Hypothalamus gefunden werden, und diese Daten dann mit der sexuellen Orientierung von Erwachsenen korreliert.
Studien zur Hirnstruktur
Von einer Reihe von Gehirnabschnitten wurde berichtet, dass sie sexuell dimorph sind; das heißt, sie variieren zwischen Männern und Frauen. Es gibt auch Berichte über Variationen in der Gehirnstruktur, die der sexuellen Orientierung entsprechen. 1990 berichteten Dick Swaab und Michel A. Hofman über einen Unterschied in der Größe des suprachiasmatischen Kerns zwischen homosexuellen und heterosexuellen Männern. Im Jahr 1992 berichteten Allen und Gorski über einen Unterschied in Bezug auf die sexuelle Orientierung in der Größe der vorderen Kommissur , aber diese Forschung wurde durch zahlreiche Studien widerlegt, von denen eine ergab, dass die Gesamtheit der Variation durch einen einzigen Ausreißer verursacht wurde.
Die Erforschung der physiologischen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen basiert auf der Idee, dass Menschen ein männliches oder ein weibliches Gehirn haben, und dies spiegelt die Verhaltensunterschiede zwischen den beiden Geschlechtern wider. Einige Forscher stellen fest, dass hierfür eine solide wissenschaftliche Unterstützung fehlt. Obwohl konsistente Unterschiede festgestellt wurden, einschließlich der Größe des Gehirns und bestimmter Hirnregionen, sind männliche und weibliche Gehirne sehr ähnlich.
Geschlechtsdimorphe Kerne im vorderen Hypothalamus
LeVay führte auch einige dieser frühen Forschungen durch. Er untersuchte vier Gruppen von Neuronen im Hypothalamus namens INAH1, INAH2, INAH3 und INAH4. Dies war ein relevanter Bereich des Gehirns, der untersucht werden sollte, da Beweise dafür vorliegen, dass er bei der Regulierung des Sexualverhaltens bei Tieren eine Rolle spielt , und weil zuvor berichtet wurde, dass sich INAH2 und INAH3 in der Größe zwischen Männern und Frauen unterscheiden.
Er erhielt Gehirne von 41 verstorbenen Krankenhauspatienten. Die Probanden wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe umfasste 19 schwule Männer, die an AIDS- bedingten Krankheiten gestorben waren . Die zweite Gruppe umfasste 16 Männer, deren sexuelle Orientierung unbekannt war, von denen die Forscher jedoch vermuteten, dass sie heterosexuell waren. Sechs dieser Männer waren an AIDS-bedingten Krankheiten gestorben. Die dritte Gruppe bestand aus sechs Frauen, von denen die Forscher vermuteten, dass sie heterosexuell waren. Eine der Frauen war an einer AIDS-bedingten Krankheit gestorben.
Die HIV-positiven Personen in den vermutlich heterosexuellen Patientengruppen wurden alle aus den Krankenakten entweder als intravenös Drogenabhängige oder als Empfänger von Bluttransfusionen identifiziert . Zwei der Männer, die sich als heterosexuell identifizierten, bestritten ausdrücklich, jemals einen homosexuellen Sexualakt begangen zu haben. Die Aufzeichnungen der übrigen heterosexuellen Probanden enthielten keine Informationen über ihre sexuelle Orientierung; sie seien "aufgrund des zahlenmäßigen Übergewichts heterosexueller Männer in der Bevölkerung" überwiegend oder ausschließlich heterosexuell gewesen.
LeVay fand keine Hinweise auf einen Unterschied zwischen den Gruppen in der Größe von INAH1, INAH2 oder INAH4. Allerdings schien die INAH3-Gruppe in der heterosexuellen männlichen Gruppe doppelt so groß zu sein wie in der schwulen männlichen Gruppe; der Unterschied war hochsignifikant und blieb signifikant, wenn nur die sechs AIDS-Patienten in die heterosexuelle Gruppe eingeschlossen wurden. Die Größe von INAH3 in den Gehirnen homosexueller Männer war vergleichbar mit der Größe von INAH3 in den Gehirnen heterosexueller Frauen.
William Byne und Kollegen versuchten, die in INAH 1–4 berichteten Größenunterschiede zu identifizieren, indem sie das Experiment mit Gehirnproben von anderen Probanden replizierten: 14 HIV-positive homosexuelle Männer, 34 mutmaßlich heterosexuelle Männer (10 HIV-positiv) und 34 mutmaßlich heterosexuelle Frauen (9 HIV-positiv). Die Forscher fanden einen signifikanten Unterschied in der INAH3-Größe zwischen heterosexuellen Männern und heterosexuellen Frauen. Die INAH3-Größe der homosexuellen Männer war offensichtlich kleiner als die der heterosexuellen Männer und größer als die der heterosexuellen Frauen, obwohl keiner der Unterschiede statistisch signifikant war.
Byne und Kollegen wogen und zählten auch die Anzahl der Neuronen in INAH3-Tests, die nicht von LeVay durchgeführt wurden. Die Ergebnisse für das INAH3-Gewicht waren denen für die INAH3-Größe ähnlich; das heißt, das INAH3-Gewicht für die heterosexuellen männlichen Gehirne war signifikant größer als für die heterosexuellen weiblichen Gehirne, während die Ergebnisse für die schwule männliche Gruppe zwischen denen der anderen beiden Gruppen lagen, sich aber nicht signifikant von beiden unterschieden. Die Neuronenzahl fand auch einen männlich-weiblichen Unterschied in INAH3, aber keinen Trend in Bezug auf die sexuelle Orientierung.
LeVay hat gesagt, dass Byne seine Arbeit repliziert hat, aber dass er eine zweiseitige statistische Analyse verwendet hat, die normalerweise reserviert ist, wenn keine früheren Ergebnisse den Unterschied verwendet hatten. LeVay sagte: „Da meine Studie bereits berichtet hatte, dass ein INAH3 bei schwulen Männern kleiner ist, wäre ein einseitiger Ansatz angemessener gewesen und hätte einen signifikanten Unterschied [zwischen heterosexuellen und homosexuellen Männern] ergeben“.
J. Michael Bailey hat LeVays Kritiker kritisiert und die Behauptung, dass der INAH-3-Unterschied auf AIDS zurückzuführen sein könnte, als "erschwerend" bezeichnet, da "INAH-3 sich nicht zwischen den Gehirnen von heterosexuellen Männern, die an AIDS starben, und denen, die an AIDS starben, unterschieden" hatte die Krankheit nicht". Bailey kritisierte weiter den zweiten Einwand, der vorgebracht wurde, dass Homosexualität irgendwie den Unterschied in INAH-3 verursacht haben könnte und nicht umgekehrt, und sagte: „Das Problem mit dieser Idee ist, dass sich der Hypothalamus anscheinend früh entwickelt Experte, den ich jemals zu LeVays Studie befragt habe, hielt es für plausibel, dass Sexualverhalten die INAH-3-Unterschiede verursacht."
Der SCN homosexueller Männer ist nachweislich größer (sowohl das Volumen als auch die Anzahl der Neuronen sind doppelt so hoch wie bei heterosexuellen Männern). Diese Bereiche des Hypothalamus wurden bisher weder bei homosexuellen Frauen noch bei bisexuellen Männern oder Frauen untersucht. Obwohl die funktionellen Implikationen solcher Befunde noch nicht im Detail untersucht wurden, werfen sie ernsthafte Zweifel an der weithin akzeptierten Dörner-Hypothese, dass homosexuelle Männer einen "weiblichen Hypothalamus" haben und dass der Schlüsselmechanismus zur Unterscheidung des "männlichen Gehirns vom ursprünglich weiblichen Gehirn" ist der epigenetische Einfluss von Testosteron während der pränatalen Entwicklung.
Eine Studie von Garcia-Falgueras und Swaab aus dem Jahr 2010 stellte fest, dass „das fötale Gehirn sich während der intrauterinen Phase in männlicher Richtung durch eine direkte Wirkung von Testosteron auf die sich entwickelnden Nervenzellen oder in weiblicher Richtung durch das Fehlen dieses Hormonschubs entwickelt.“ Auf diese Weise werden unsere Geschlechtsidentität (die Überzeugung der Zugehörigkeit zum männlichen oder weiblichen Geschlecht) und sexuelle Orientierung bereits im Mutterleib in unsere Gehirnstrukturen einprogrammiert bzw. organisiert.Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das soziale Umfeld nach der Geburt einen Einfluss auf Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung."
Schafmodell
Der Hausbock wird als experimentelles Modell verwendet, um die frühe Programmierung der neuronalen Mechanismen zu untersuchen, die der Homosexualität zugrunde liegen, und entwickelt sich aus der Beobachtung, dass etwa 8% der Hausböcke im Vergleich zur Mehrheit der Widder sexuell von anderen Widdern (männlich orientiert) angezogen werden die weiblich ausgerichtet sind. Bei vielen Arten ist ein herausragendes Merkmal der Geschlechtsdifferenzierung das Vorhandensein eines sexuell dimorphen Kerns (SDN) im präoptischen Hypothalamus, der bei Männern größer ist als bei Frauen.
Roselliet al. entdeckten ein Schaf-SDN (oSDN) im präoptischen Hypothalamus, das bei männlichen Widdern kleiner ist als bei weiblich-orientierten Widdern, aber ähnlich groß wie das oSDN von Weibchen. Neuronen des oSDN zeigen eine Aromatase- Expression, die bei männlich-orientierten Widdern im Vergleich zu weiblich-orientierten Widdern ebenfalls geringer ist, was darauf hindeutet, dass die sexuelle Orientierung neurologisch fest verdrahtet ist und durch Hormone beeinflusst werden kann. Die Ergebnisse konnten jedoch die Rolle der neuralen Aromatase bei der sexuellen Differenzierung des Gehirns und des Verhaltens bei Schafen nicht in Verbindung bringen, da die Präferenz von erwachsenen Sexualpartnern oder das oSDN-Volumen aufgrund der Aromatase-Aktivität im Gehirn der Föten nicht entfeminisiert wurden die kritische Phase. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass oSDN-Morphologie und Homosexualität durch einen Androgenrezeptor programmiert werden, der keine Aromatisierung beinhaltet . Die meisten Daten deuten darauf hin, dass homosexuelle Widder, wie auch weiblich orientierte Widder, in Bezug auf Reiten, Empfänglichkeit und Gonadotropinsekretion maskulinisiert und defeminisiert sind, aber nicht für Sexualpartnerpräferenzen, was auch darauf hindeutet, dass solche Verhaltensweisen anders programmiert werden können. Obwohl die genaue Funktion des oSDN nicht vollständig bekannt ist, scheinen sein Volumen, seine Länge und seine Zellzahl mit der sexuellen Orientierung zu korrelieren, und ein Dimorphismus seines Volumens und der Zellen könnte die Verarbeitungssignale beeinflussen, die bei der Partnerauswahl beteiligt sind. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Anforderungen und das Timing der Entwicklung des oSDN zu verstehen und wie sich die pränatale Programmierung auf den Ausdruck der Partnerwahl im Erwachsenenalter auswirkt.
Nichtkonformität des Geschlechts in der Kindheit
Die geschlechtsspezifische Nichtkonformität in der Kindheit ist ein starker Prädiktor für die sexuelle Orientierung von Erwachsenen, der in der Forschung konsequent repliziert wurde und als starker Beweis für einen biologischen Unterschied zwischen Heterosexuellen und Nicht-Heterosexuellen gilt. In einer von J. Michael Bailey verfassten Rezension heißt es: „Die geschlechtsspezifische Nonkonformität in der Kindheit umfasst die folgenden Phänomene bei Jungen: Cross-Dressing, Wunsch nach langen Haaren, Spiel mit Puppen, Abneigung gegen Wettkampfsport und raues Spiel, Bevorzugung von Mädchen als Spielkameraden, erhöhte Trennung Angst und der Wunsch, ein Mädchen zu sein oder zu glauben, dass man ein Mädchen ist. und der Wunsch, ein Junge zu sein". Dieses geschlechtsunkonforme Verhalten tritt typischerweise im Vorschulalter auf, ist jedoch oft bereits im Alter von 2 Jahren sichtbar. Kinder werden nur dann als geschlechtsunkonform betrachtet, wenn sie sich dauerhaft an einer Vielzahl dieser Verhaltensweisen beteiligen, im Gegensatz zu ein paar Mal oder auf ein Verhalten Gelegenheit. Es ist auch kein eindimensionales Merkmal, sondern hat eher unterschiedliche Ausprägungen.
Kinder, die nicht heterosexuell aufwachsen, waren in der Kindheit im Durchschnitt wesentlich stärker geschlechtsunangepasst. Dies wird sowohl in retrospektiven Studien bestätigt, in denen Homosexuelle, Bisexuelle und Heterosexuelle zu ihrem geschlechtstypischen Verhalten in der Kindheit befragt werden, als auch in prospektiven Studien, in denen stark geschlechtsunkonforme Kinder von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter begleitet werden, um ihre sexuelle Orientierung herauszufinden. Eine Überprüfung retrospektiver Studien, in denen geschlechtsneutrale Merkmale gemessen wurden, schätzte, dass 89 % der homosexuellen Männer das Niveau der Geschlechtsabweichung bei heterosexuellen Männern überschritten, während nur 2 % der heterosexuellen Männer den homosexuellen Median überschritten. Bei der weiblichen sexuellen Orientierung waren es 81% bzw. 12%. Auch eine Vielzahl weiterer Auswertungen, wie beispielsweise Heimvideos aus der Kindheit, Fotos und Berichte von Eltern, bestätigen diesen Befund. Kritiker dieser Forschung sehen darin eine Bestätigung von Stereotypen; jedoch hat keine Studie jemals gezeigt, dass diese Forschung die geschlechtsspezifische Nichtkonformität in der Kindheit übertrieben hat. J. Michael Bailey argumentiert, dass schwule Männer oft leugnen, dass sie in ihrer Kindheit nicht geschlechtskonform waren, weil sie möglicherweise von Gleichaltrigen und Eltern gemobbt oder misshandelt wurden und weil sie Weiblichkeit bei anderen schwulen Männern oft nicht attraktiv finden und daher nicht wollen an sich anzuerkennen. Zusätzliche Forschungen in westlichen Kulturen und nicht-westlichen Kulturen, einschließlich Lateinamerika, Asien, Polynesien und dem Nahen Osten, unterstützen die Gültigkeit der geschlechtsspezifischen Nichtkonformität in der Kindheit als Prädiktor für die Nicht-Heterosexualität bei Erwachsenen.
Diese Forschung bedeutet nicht, dass alle Nicht-Heterosexuelle nicht geschlechtskonform waren, sondern zeigt vielmehr, dass sich Nicht-Heterosexuelle im Durchschnitt merklich von anderen Kindern unterscheiden, lange bevor sexuelle Anziehung bekannt ist. Es gibt wenig Beweise dafür, dass geschlechtsunkonforme Kinder dazu ermutigt oder gelehrt wurden, sich so zu verhalten; vielmehr tritt trotz konventioneller Sozialisation typischerweise eine geschlechtsspezifische Nichtkonformität in der Kindheit auf. Medizinische Experimente, bei denen Jungen im Säuglingsalter geschlechtsspezifisch neu zugeordnet und als Mädchen aufgezogen wurden, machten sie weder weiblich noch attraktiv für Männer.
Jungen, die chirurgisch neu zugewiesen wurden, weiblich
Zwischen den 1960er und 2000er Jahren wurden viele neugeborene und Säuglinge chirurgisch als Frauen neu zugeordnet, wenn sie mit missgebildeten Penissen geboren wurden oder ihren Penis bei Unfällen verloren hatten. Viele Chirurgen glaubten, dass solche Männer glücklicher wären, wenn sie sozial und chirurgisch neu zugewiesen würden. In allen sieben veröffentlichten Fällen, die Informationen zur sexuellen Orientierung lieferten, wurden die Probanden von Frauen angezogen. Sechs Fälle wurden ausschließlich von Frauen angezogen, wobei ein Fall „überwiegend“ von Frauen angezogen wurde. In einem Übersichtsartikel in der Zeitschrift Psychological Science im Interesse der Öffentlichkeit , sechs Forscher einschließlich J. Michael Bailey Zustand dies stellt ein starkes Argument , dass männliche sexuelle Orientierung zum Teil vor der Geburt festgelegt ist:
Dies ist das Ergebnis, das wir erwarten würden, wenn die männliche sexuelle Orientierung ausschließlich auf die Natur zurückzuführen wäre, und es ist das Gegenteil des Ergebnisses, das wir erwarten würden, wenn sie auf die Erziehung zurückzuführen wäre. In diesem Fall würden wir erwarten, dass sich keine dieser Personen überwiegend zu Frauen hingezogen fühlen würde. Sie zeigen, wie schwer es ist, die Entwicklung der männlichen sexuellen Orientierung mit psychosozialen Mitteln zu entgleisen.
Sie argumentieren weiter, dass dies Fragen über die Bedeutung des sozialen Umfelds für die sexuelle Orientierung aufwirft, und stellen fest: "Wenn man einen männlichen Menschen nicht zuverlässig dazu bringen kann, sich von anderen Männern angezogen zu fühlen, indem man ihm im Säuglingsalter seinen Penis abschneidet und ihn als Mädchen aufzieht, was dann? andere psychosoziale Interventionen könnten diesen Effekt plausibel haben?" Es wird weiter festgestellt, dass weder Kloakenekstrophie (die zu einem missgebildeten Penis führt) noch chirurgische Unfälle mit Anomalien von pränatalen Androgenen verbunden sind, so dass die Gehirne dieser Personen bei der Geburt männlich organisiert waren. Sechs der sieben wurden bei der Nachuntersuchung als heterosexuelle Männer identifiziert, obwohl sie chirurgisch verändert und als Frauen aufgezogen wurden eine Art und Weise wie möglich." Baileyet al. beschreiben diese Geschlechtsumwandlungen als „das nahezu perfekte Quasi-Experiment“ bei der Messung des Einflusses von „Natur“ gegenüber „Erziehung“ in Bezug auf männliche Homosexualität.
'Exotik wird Erotik'-Theorie
Daryl Bem , Sozialpsychologe an der Cornell University , hat die Theorie aufgestellt, dass der Einfluss biologischer Faktoren auf die sexuelle Orientierung durch Erfahrungen in der Kindheit vermittelt werden kann. Das Temperament eines Kindes prädisponiert das Kind, bestimmte Aktivitäten anderen vorzuziehen. Aufgrund ihres Temperaments, das von biologischen Variablen wie genetischen Faktoren beeinflusst wird, werden einige Kinder von Aktivitäten angezogen, die anderen Kindern des gleichen Geschlechts häufig Spaß machen. Andere bevorzugen Aktivitäten, die typisch für ein anderes Geschlecht sind. Dies wird dazu führen, dass sich ein geschlechtskonformes Kind anders fühlt als Kinder des anderen Geschlechts, während sich geschlechtsnichtkonforme Kinder anders fühlen als Kinder ihres eigenen Geschlechts. Laut Bem wird dieses Unterschiedsgefühl psychologische Erregung hervorrufen, wenn das Kind in der Nähe von Mitgliedern des Geschlechts ist, das es als „anders“ betrachtet. Bem theoretisiert, dass diese psychologische Erregung später in sexuelle Erregung umgewandelt wird: Kinder fühlen sich sexuell von dem Geschlecht angezogen, das sie als unterschiedlich ansehen ("exotisch"). Dieser Vorschlag ist als "Exotik wird Erotik"-Theorie bekannt. Wetherell et al. stellen fest, dass Bem "sein Modell nicht als absolutes Rezept für alle Individuen beabsichtigt, sondern eher als modale oder durchschnittliche Erklärung."
Zwei Kritiken von Bems Theorie in der Zeitschrift Psychological Review kamen zu dem Schluss, dass "von Bem zitierte Studien und zusätzliche Forschung zeigen, dass [die] Exotic Becomes Erotic-Theorie nicht durch wissenschaftliche Beweise gestützt wird." Bem wurde dafür kritisiert, dass er sich auf eine nicht zufällige Stichprobe schwuler Männer aus den 1970er Jahren stützte (anstatt neue Daten zu sammeln) und Schlussfolgerungen zog, die den ursprünglichen Daten zu widersprechen scheinen. Eine "Prüfung der Originaldaten ergab, dass praktisch alle Befragten mit Kindern beiderlei Geschlechts vertraut waren", und dass nur 9 % der schwulen Männer angaben, dass "keiner oder nur wenige" ihrer Freunde männlich seien, und die meisten schwulen Männer (74% ) berichtete, in der Grundschule „einen besonders engen Freund des gleichen Geschlechts“ gehabt zu haben. „71 % der schwulen Männer gaben an, sich von anderen Jungen zu unterscheiden, aber auch 38 % der heterosexuellen Männer. Bem räumte auch ein, dass schwule Männer eher ältere Brüder haben (der brüderliche Geburtsreihenfolgeeffekt ), was einer Unvertrautheit mit Männern zu widersprechen schien. Bem zitierte kulturübergreifende Studien, die auch "der Behauptung der EBE-Theorie zu widersprechen scheinen", wie der Sambia- Stamm in Papua-Neuguinea, der homosexuelle Handlungen unter Teenagern rituell erzwang; Doch sobald diese Jungen das Erwachsenenalter erreichten, zeigte nur ein kleiner Teil der Männer weiterhin homosexuelles Verhalten – ähnlich wie in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus könnte Bems Modell so interpretiert werden, dass man, wenn man das Verhalten eines Kindes ändern könnte, auch seine sexuelle Orientierung ändern könnte, aber die meisten Psychologen bezweifeln, dass dies möglich wäre.
Der Neurowissenschaftler Simon LeVay sagte, dass Bems Theorie zwar in einer „glaubwürdigen zeitlichen Ordnung“ angeordnet sei, dass ihr aber letztlich „empirische Unterstützung fehlt“. Der Sozialpsychologe Justin Lehmiller stellte fest, dass Bems Theorie "für die nahtlose Verknüpfung von biologischen und Umwelteinflüssen" gelobt wurde und dass "das Modell auch in dem Sinne unterstützt wird, dass die geschlechtsspezifische Nichtkonformität in der Kindheit tatsächlich einer der stärksten Prädikatoren für Erwachsene ist". Homosexualität", aber dass die Gültigkeit des Modells "aus zahlreichen Gründen in Frage gestellt und von Wissenschaftlern weitgehend abgelehnt wurde".
Sexuelle Orientierung und Evolution
Allgemein
Sexuelle Praktiken , die signifikant die Häufigkeit von heterosexuellem Geschlechtsverkehr reduzieren auch erheblich verringern die Chancen für eine erfolgreiche Reproduktion, und aus diesem Grunde würden sie zu sein scheinen maladaptiven in einem evolutionären Kontext nach einem einfachen darwinistischen Modell (Wettbewerb zwischen Individuen) der natürlichen Auslese-on der Annahme, dass Homosexualität diese Häufigkeit reduzieren würde. Mehrere Theorien wurden aufgestellt, um diesen Widerspruch zu erklären, und neue experimentelle Beweise haben ihre Durchführbarkeit gezeigt.
Einige Wissenschaftler haben vorgeschlagen, dass Homosexualität indirekt adaptiv ist, indem sie heterosexuellen Geschwistern oder ihren Kindern auf nicht offensichtliche Weise einen reproduktiven Vorteil verleiht, ein hypothetischer Fall von Verwandtschaftsselektion . Analog dazu verleiht das Allel (eine bestimmte Version eines Gens), das beim Vorliegen von zwei Kopien die Sichelzellenanämie verursacht , auch Resistenz gegen Malaria mit einer geringeren Form der Anämie, wenn eine Kopie vorhanden ist (dies wird als heterozygoter Vorteil bezeichnet ). .
Brendan Zietsch vom Queensland Institute of Medical Research schlägt die alternative Theorie vor, dass Männer mit weiblichen Merkmalen für Frauen attraktiver werden und sich daher eher paaren, vorausgesetzt, die beteiligten Gene treiben sie nicht zu einer vollständigen Ablehnung der Heterosexualität.
In einer Studie aus dem Jahr 2008 stellten die Autoren fest: "Es gibt erhebliche Beweise dafür, dass die sexuelle Orientierung des Menschen genetisch beeinflusst ist, daher ist nicht bekannt, wie Homosexualität, die zu einem geringeren Fortpflanzungserfolg neigt, in der Bevölkerung relativ häufig aufrechterhalten wird." Sie stellten die Hypothese auf, dass "während Gene, die für Homosexualität prädisponieren, den Fortpflanzungserfolg von Homosexuellen reduzieren, sie Heterosexuellen, die sie tragen, einen gewissen Vorteil verschaffen können". Ihre Ergebnisse legten nahe, dass "Gene, die für Homosexualität prädisponieren, Heterosexuellen einen Paarungsvorteil verleihen können, was dazu beitragen könnte, die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Homosexualität in der Bevölkerung zu erklären". In derselben Studie stellten die Autoren jedoch fest, dass "nichtgenetische alternative Erklärungen nicht ausgeschlossen werden können" als Grund dafür, dass der Heterosexuelle im homosexuell-heterosexuellen Zwillingspaar mehr Partner hat, und nannten insbesondere "sozialen Druck auf den anderen Zwilling, in einem heterosexueller Weg" (und damit eine größere Anzahl von Sexualpartnern suchen) als Beispiel für eine alternative Erklärung. Die Studie räumt ein, dass eine große Anzahl von Sexualpartnern möglicherweise nicht zu einem größeren Fortpflanzungserfolg führt, und stellt insbesondere fest, dass es „keine Beweise für die Anzahl der Sexualpartner und den tatsächlichen Fortpflanzungserfolg gibt, entweder in der Gegenwart oder in unserer evolutionären Vergangenheit“.
Die Hypothese des heterosexuellen Vorteils wurde durch die italienische Studie aus dem Jahr 2004, die eine erhöhte Fruchtbarkeit bei weiblichen matrilinearen Verwandten schwuler Männer zeigte, stark unterstützt . Wie Hamer ursprünglich betonte, könnte selbst ein bescheidener Anstieg der Reproduktionsfähigkeit bei Frauen, die ein "Schwulen-Gen" tragen, leicht dafür verantwortlich sein, dass es in der Population auf einem hohen Niveau gehalten wird.
Homosexueller Onkel Hypothese
Die „Schwulen-Onkel-Hypothese“ geht davon aus, dass Menschen, die selbst keine Kinder haben, dennoch die Prävalenz der Gene ihrer Familie in zukünftigen Generationen erhöhen können, indem sie den Nachkommen ihrer nächsten Verwandten Ressourcen (z. B. Nahrung, Aufsicht, Verteidigung, Unterkunft) zur Verfügung stellen.
Diese Hypothese ist eine Erweiterung der Theorie der Verwandtschaftsselektion , die ursprünglich entwickelt wurde, um scheinbare altruistische Handlungen zu erklären, die fehlangepasst zu sein schienen. Das ursprüngliche Konzept wurde 1932 von JBS Haldane vorgeschlagen und später von vielen anderen ausgearbeitet, darunter John Maynard Smith , WD Hamilton und Mary Jane West-Eberhard . Dieses Konzept wurde auch verwendet, um die Muster bestimmter sozialer Insekten zu erklären, bei denen die meisten Mitglieder nicht fortpflanzungsfähig sind.
Vasey und VanderLaan (2010) testeten die Theorie auf der pazifischen Insel Samoa, wo sie Frauen, heterosexuelle Männer und die fa'afafine untersuchten , Männer, die andere Männer als Sexualpartner bevorzugen und innerhalb der Kultur als eigenständige dritte Geschlechtskategorie akzeptiert werden . Vasey und VanderLaan fanden heraus, dass die Fa'afafine deutlich mehr bereit waren, Verwandten zu helfen, aber viel weniger daran interessiert waren, Kindern zu helfen, die nicht zur Familie gehören.
Die Hypothese stimmt mit anderen Studien zur Homosexualität überein, die zeigen, dass sie sowohl bei Geschwistern als auch bei Zwillingen häufiger vorkommt.
Vasey und VanderLaan (2011) zeigen, dass ein kollektivistischer kultureller Kontext an sich nicht ausreicht, um einen solchen Phänotyp auszudrücken, wenn ein adaptiv gestalteter avunkulärer androphiler männlicher Phänotyp existiert und seine Entwicklung von einem bestimmten sozialen Umfeld abhängig ist.
Biologische Unterschiede bei schwulen Männern und lesbischen Frauen
Einige Studien haben Korrelationen zwischen der Physiologie von Menschen und ihrer Sexualität gefunden; Diese Studien liefern Beweise, die darauf hindeuten, dass:
- Schwule und heterosexuelle Frauen haben im Durchschnitt gleich große Gehirnhälften. Lesbische Frauen und heterosexuelle Männer haben im Durchschnitt etwas größere rechte Gehirnhälften.
- Der suprachiasmatic Kern des Hypothalamus wurde von Swaab und Hopffman um größer zu sein in Homosexuell Männern als bei Nicht-Homosexuell Männern gefunden; der suprachiasmatische Nucleus ist auch bekannt, dass er bei Männern größer ist als bei Frauen.
- Schwule Männer berichten im Durchschnitt über etwas längere und dickere Penisse als nicht schwule Männer.
- Die durchschnittliche Größe von INAH 3 im Gehirn schwuler Männer ist ungefähr gleich groß wie INAH 3 bei Frauen, die deutlich kleiner und die Zellen dichter gepackt sind als in Gehirnen heterosexueller Männer.
- Es wurde festgestellt, dass die vordere Kommissur bei schwulen Männern größer ist als bei Frauen und heterosexuellen Männern, aber eine spätere Studie fand keinen solchen Unterschied.
- Die Funktion des Innenohrs und des zentralen Hörsystems bei lesbischen und bisexuellen Frauen ähneln eher den funktionellen Eigenschaften von Männern als von nicht schwulen Frauen (die Forscher argumentierten, dass dieser Befund mit der pränatalen Hormontheorie der sexuellen Orientierung übereinstimmt ).
- Die Schreckreaktion (Augenblinzeln nach einem lauten Geräusch) ist bei lesbischen und bisexuellen Frauen ähnlich maskulinisiert.
- Das Gehirn von Schwulen und Nicht-Schwulen reagiert unterschiedlich auf zwei mutmaßliche Sexualpheromone (AND, gefunden in männlichen Achselhöhlensekreten und EST, gefunden in weiblichem Urin).
- Die Amygdala , eine Region des Gehirns, ist bei schwulen Männern aktiver als bei nicht-schwulen Männern, wenn sie sexuell erregendem Material ausgesetzt ist.
- Es wurde berichtet, dass das Verhältnis der Fingerlänge zwischen Zeige- und Ringfinger im Durchschnitt zwischen nicht schwulen und lesbischen Frauen unterschiedlich ist.
- Schwule und Lesben sind deutlich häufiger Linkshänder oder beidhändig als nicht-schwule Männer und Frauen; Simon LeVay argumentiert, dass, weil „[h]und Präferenz vor der Geburt beobachtbar ist… Vererbung.
- Eine Studie mit über 50 schwulen Männern ergab, dass etwa 23% Haarwirbel gegen den Uhrzeigersinn hatten , im Gegensatz zu 8% in der Allgemeinbevölkerung. Dies kann mit Linkshändigkeit korrelieren.
- Schwule Männer haben eine erhöhte Rillendichte in den Fingerabdrücken auf ihren linken Daumen und kleinen Fingern .
- Die Länge der Gliedmaßen und Hände schwuler Männer ist im Vergleich zur Körpergröße geringer als bei der allgemeinen Bevölkerung, jedoch nur bei weißen Männern.
J. Michael Bailey hat argumentiert, dass das frühkindliche geschlechtsunkonforme Verhalten von Homosexuellen im Gegensatz zu biologischen Merkmalen ein besserer Beweis dafür ist, dass Homosexualität ein angeborenes Merkmal ist. Er argumentiert , dass Homosexuell Männer „bestraft viel mehr als belohnt“ werden für ihre Kindheit Geschlecht Nonkonformismus, und dass ein solches Verhalten „entsteht ohne Ermutigung, und trotz der Opposition“, so dass es „das sine qua non des innateness“.
Politische Aspekte
Ob genetische oder andere physiologische Determinanten die Grundlage der sexuellen Orientierung bilden, ist ein stark politisiertes Thema. The Advocate , ein US-amerikanisches Nachrichtenmagazin für Schwulen und Lesben, berichtete 1996, dass 61% seiner Leser glaubten, dass "es vor allem den Rechten von Schwulen und Lesben helfen würde, wenn Homosexualität biologisch determiniert wäre". Eine länderübergreifende Studie in den Vereinigten Staaten , den Philippinen und Schweden ergab, dass diejenigen, die glaubten, dass "Homosexuelle so geboren werden", eine signifikant positivere Einstellung zur Homosexualität hatten als diejenigen, die glaubten, dass "Homosexuelle so leben" oder " lernen, so zu sein".
Die Analyse des gleichen Schutzes nach US-Recht bestimmt, wann staatliche Anforderungen eine „verdächtige Klassifizierung“ von Gruppen verursachen und daher aufgrund mehrerer Faktoren, von denen einer die Unveränderlichkeit ist, einer verstärkten Prüfung unterzogen werden können .
Der Nachweis, dass die sexuelle Orientierung biologisch bedingt (und daher möglicherweise im rechtlichen Sinne unveränderlich) ist, würde die Rechtsgrundlage für eine verstärkte Prüfung von Gesetzen, die auf dieser Grundlage diskriminieren, stärken.
Die wahrgenommenen Ursachen der sexuellen Orientierung haben einen erheblichen Einfluss auf den Status sexueller Minderheiten in den Augen sozialkonservativer Personen. Der Family Research Council , eine konservative christliche Denkfabrik in Washington, DC, argumentiert in dem Buch Getting It Straight, dass die Feststellung, dass Menschen schwul geboren werden, „die Idee fördern würde, dass die sexuelle Orientierung ein angeborenes Merkmal ist, wie die Rasse; dass Homosexuelle wie Afrikaner Amerikaner sollten rechtlich vor "Diskriminierung" geschützt werden; und dass die Ablehnung von Homosexualität ebenso gesellschaftlich stigmatisiert werden sollte wie Rassismus. Das stimmt jedoch nicht." Auf der anderen Seite haben einige Sozialkonservative wie Reverend Robert Schenck argumentiert, dass die Menschen jeden wissenschaftlichen Beweis akzeptieren können, während sie Homosexualität immer noch moralisch ablehnen. Orson Scott Card, Vorstandsmitglied der National Organization for Marriage und Romanautor, hat die biologische Forschung zur Homosexualität unterstützt und schreibt, dass "unsere wissenschaftlichen Bemühungen in Bezug auf Homosexualität darin bestehen sollten, genetische und uterine Ursachen zu identifizieren ... damit die Häufigkeit dieser Dysfunktion minimiert werden kann". .... [Dies sollte jedoch nicht als Angriff auf Homosexuelle angesehen werden, als Wunsch, einen Völkermord an der homosexuellen Gemeinschaft zu begehen... Es gibt kein "Heilmittel" für Homosexualität, weil es keine Krankheit ist. Es gibt , jedoch unterschiedliche Lebensweisen mit homosexuellen Begierden."
Einige Befürworter der Rechte sexueller Minderheiten widersetzen sich dem, was sie als Versuche ansehen, „abweichende“ Sexualität zu pathologisieren oder zu medikalisieren, und entscheiden sich dafür, in einem moralischen oder sozialen Bereich um Akzeptanz zu kämpfen. Der Journalist Chandler Burr hat erklärt, dass "man in Erinnerung an frühere psychiatrische "Behandlungen" von Homosexualität in der biologischen Suche die Saat des Völkermords erkennt. Sie beschwören das Gespenst der chirurgischen oder chemischen "Neuverkabelung" von Schwulen herauf, oder von Abtreibungen fetaler Homosexueller, die im Mutterleib gejagt wurden." LeVay hat als Antwort auf Briefe von Schwulen und Lesben mit solcher Kritik gesagt, dass die Forschung "zum Status von Schwulen in der Gesellschaft beigetragen hat".
Siehe auch
- Gegen die Natur?
- Umfeld und sexuelle Orientierung
- Epigenetische Theorien der Homosexualität
- Homosexuell Bombe
- Homosexuelles Verhalten bei Tieren
- Neurowissenschaften und sexuelle Orientierung
- Reaktionsnormen
- Ursachen der Transsexualität
Verweise
Weiterlesen
- "Zweifel am 'Schwulen-Gen ' " . BBC-Nachrichten . 23.04.1999.
- Byne W (Mai 1994). „Die biologischen Beweise in Frage gestellt“ . Wissenschaftlicher Amerikaner . 270 (5): 50–5. Bibcode : 1994SciAm.270e..50B . doi : 10.1038/scientificamerican0594-50 . PMID 8197445 .
- Muscarella F, Fink B, Grammer K, Kirk-Smith M (Dezember 2001). "Homosexuelle Orientierung bei Männern: evolutionäre und ethologische Aspekte" (PDF) . Briefe zur Neuroendokrinologie . 22 (6): 393–400. PMID 11781535 . Archiviert vom Original (PDF) am 05.10.2018.
- Rahman Q (2005). „Die neurologische Entwicklung der menschlichen sexuellen Orientierung“. Neurowissenschaften und Bioverhaltensbewertungen . 29 (7): 1057–66. doi : 10.1016/j.neubiorev.2005.03.002 . PMID 16143171 . S2CID 15481010 .
- Rines JP, vom Saal FS (Juni 1984). „Fötale Auswirkungen auf das Sexualverhalten und die Aggression bei jungen und alten weiblichen Mäusen, die mit Östrogen und Testosteron behandelt wurden“. Hormone und Verhalten . 18 (2): 117–29. doi : 10.1016/0018-506X(84)90037-0 . PMID 6539747 . S2CID 37946760 .
- Veniegas RC, Conley TD (2000). „Biologische Forschung zu sexuellen Orientierungen von Frauen: Bewertung der wissenschaftlichen Beweise“. Zeitschrift für soziale Fragen . 56 (2): 267–282. doi : 10.1111/0022-4537.00165 .
- Ryan BC, Vandenbergh JG (Oktober 2002). „Intrauterine Positionseffekte“. Neurowissenschaften und Bioverhaltensbewertungen . 26 (6): 665–78. doi : 10.1016/S0149-7634(02)00038-6 . PMID 12479841 . S2CID 27722357 .
- LeVay S. , Hamer DH (Mai 1994). „Beweise für einen biologischen Einfluss in der männlichen Homosexualität“. Wissenschaftlicher Amerikaner . 270 (5): 44–9. Bibcode : 1994SciAm.270e..44L . doi : 10.1038/scientificamerican0594-44 . PMID 8197444 .
- vom Saal FS (Juli 1989). "Sexuelle Differenzierung bei Wurf tragenden Säugetieren: Einfluss des Geschlechts benachbarter Föten in utero" . Zeitschrift für Tierwissenschaften . 67 (7): 1824–40. doi : 10.2527/jas1989.6771824x . PMID 2670873 .
- vom Saal FS, Bronson FH (Mai 1980). "Sexuelle Eigenschaften von erwachsenen weiblichen Mäusen korrelieren mit ihrem Bluttestosteronspiegel während der pränatalen Entwicklung". Wissenschaft . 208 (4444): 597–9. Bibcode : 1980Sci...208..597V . doi : 10.1126/science.7367881 . PMID 7367881 .